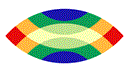Natürlich ist das ein großes Problem. Hunderttausende von Eltern mussten 1945 in Deutschland damit fertig werden. Eins war jedenfalls klar: Es war unmöglich, sie durch physische Kraft zu schützen. Manchmal konnte man sie dadurch schützen, dass man die Sieger bestach, aber das gab nur vorübergehend Sicherheit.
Die meisten Menschen mögen über den Schrecken dieser Tage nicht sprechen. Nur in zwei oder drei Fällen haben wir Einzelheiten darüber gehört, wie die Menschen mit dieser Situation fertig wurden.
l945 lebte Lotte Hoffman mit ihrer etwa sechzehnjährigen Tochter in ihrer halbzerstörten Wohnung in einem Vorort von Berlin. Russische Soldaten streiften überall herum. Einige vergewaltigten und töteten, viele plünderten. Plötzlich brachen sie auch in ihre Wohnung herein. Was konnte sie tun? Sie konnte nicht Russisch, aber sie hatte eine schöne Singstimme. In ihrer Verzweiflung bat sie im Stillen Gott um Hilfe. Daraus ergab sich ganz natürlich der nächste Schritt. Sie setzte sich ans Klavier und sang deutsche Volkslieder. Bald zeigten die Soldaten, die noch einige Augenblicke zuvor anscheinend nur drohen und schreien konnten, eine ganz andere Seite. Sie standen oder saßen um das Klavier herum und jeder war auf seine Weise damit beschäftigt, den Geist, der durch die Musik in ihr Herz eingetreten war, anzuerkennen.
Von da an saßen immer dann, wenn halbbetrunkene Soldaten in der Nähe waren, ein oder zwei russische Soldaten die ganze Nacht bewaffnet in Frau Hoffmanns Zimmer, um sicherzustellen, dass sie und ihre Tochter in Sicherheit waren.
Eine amerikanische Freundin, die 30 Jahre in Dresden gelebt hatte, überlebte die drei großen Luftangriffe auf die Stadt. Diese Luftangriffe kosteten wohl 300 000 andere Einwohner das Leben.
Bevor sie Dresden verlassen und in die Vereinigten Staaten zurückkehren konnte, lebte sie 14 Monate lang unter russischer Besatzung. Während dieser Zeit führte sie sorgfältig Buch. Einige der Ereignisse sind schrecklich und zeigen direkt, welche Grausamkeit der Krieg freisetzt. Andere beleuchten den uns gemeinsamen Boden, auf dem Menschen der unterschiedlichsten Nationen zusammen stehen. Hier sind einige ihrer Erfahrungen in ihrer eigenen lebendigen Erzählweise:
„Vom Tagesanbruch des 8. Mai (1945) an erschütterte Kanonendonner den Boden so sehr, wie er seit den Bombenangriffen nicht erschüttert worden war. Das war Artilleriefeuer. Türen und Fenster hingen seit den Luftangriffen locker in den Rahmen und schepperten nun nach jedem Schlag bedrohlich. Überall standen Menschen und lauschten. Bleiche Gesichter sahen einander ungläubig an. Was für ein Wahnsinn, deutsche Jungen in dieser letzten Stunde der Katastrophe in den sicheren Tod zu schicken! Plötzlich hörte die Beschießung auf: Die Stadt Dresden oder eher das, was von ihr übrig geblieben war, hatte kapituliert. Bedingungslose Kapitulation an wen? Den Russen war das Privileg zugestanden worden, die Stadt als erste und allein einzunehmen. Eine Nachbarin klopfte an mein Fenster. Ihre Augen waren von Panik geweitet.
‚Sie kommen hierher’, keuchte sie, ‚mein Bruder hat sie gesehen! Was sollen wir nur tun?’
‚Tun? Na gar nichts’, antwortete ich mit, wie ich hoffte, fester Stimme, obwohl auch ich von Angst erfüllt war. ‚Denken Sie daran, wie viele Lügen beide Seiten während des Krieges übereinander verbreitet haben. Sie werden sehen, dass die Russen Menschen wie wir sind, jedenfalls werden sie uns nicht fressen.’
Sie wendete sich ab und schluchzte. Was konnten wir nun wirklich tun? … Das Beste hoffen und glauben.
Wir brauchten nicht lange zu warten. Ein Gewehrkolben schlug gegen die Haustür. Der alte Papa H, mein freundlicher Wirt, lief, um zu öffnen. Schroffe Stimmen im Hausflur. Ich sprang in die Höhe. Ein Soldat in russischer Uniform war in mein Zimmer eingedrungen. Eine Sekunde lang standen wir einander gegenüber und sahen uns an. Er war jung, blond, hatte blaue Augen, die dunkel vor Erregung waren. Was die wenigen Worte Russisch anging, die ich in den letzten Jahren gelernt hatte, nun, wahrscheinlich würde sie kein Russe jemals verstehen!!... Ich schluckte – lächelte: ‚Wie geht es Ihnen? Ich freue mich, sie kennen zu lernen’. Ich streckte meine Hand aus, die er mit eisernem Griff fasste und herzlich schüttelte. Er betrachtete mich, das Zimmer und die Fotografien an der Wand. Mit einer unwillkürlichen Bewegung bekreuzigte er sich schnell vor dem Bild der Sixtinischen Madonna. Dann guckte er mürrisch, als wäre er dabei ertappt worden, dass er etwas Verbotenes tat.
‚Amerrika?’
Ich nickte. ‚Ja, Towarisch, wir Freunde.’ Da lachte er fröhlich und erzählte das Blaue vom Himmel, von dem ich nur ab und zu ein Wort verstand. Ohne weitere Umstände ließ er sich auf die Couch neben mir plumpsen – und sprang sofort wieder auf. Er starrte mich mit wildem Verdacht an. ‚Schto eto takoje?’ Was ist das?
Ich sah ihn ängstlich an und verstand nicht. ‚Was ist – was?’
‚Das!’ Er schrie jetzt und zeigte auf die Couch.
‚Couch – Bett – Divan …’ Was meinte er wohl?
Er zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Couch und sah mich dabei immerzu an. Allmählich veränderte sich sein Blick und ein breites Grinsen breitete sich auf seinem sonnnengebräunten Gesicht aus. Dann ließ er sich wieder neben mich fallen. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die weichen Kissen und dann fing er an auf und ab zu springen, auf und ab, und ich, deren Hand er hielt, sprang höflich neben ihm mit. Jetzt verstand ich. Er hatte bis dahin noch nie eine elastische Polsterung erlebt! Seine Neugier erwachte. Er ging durch das Zimmer, drehte den Wasserhahn überm Waschbecken an, wo ‚Wasser aus der Wand kam’, drückte auf die kleinen wunderbaren Knöpfe an zwei Lampen, die irgendwie ‚Licht von der Decke’ herabschickten. Und dann sah er meine kleine goldene Armbanduhr, die ich vergessen hatte wegzuräumen. In Russland gibt es keine Uhrenindustrie, keinen Schmuck – er würde dem Anblick der Uhr nicht widerstehen können. Er könnte zu Hause dafür ja eine ganze Ferienhütte kaufen … Er legte die Hände ineinander wie ein Kind, das um etwas bittet. Dann nahm er die Uhr und streichelte sie mit der rechten Hand, als streichelte er etwas Lebendiges, und sah mich an.
Wäre es nicht besser, etwas freiwillig herzugeben, als es vielleicht weggenommen zu bekommen? Sie bedeutete ihm so viel, so schrecklich viel. In einer plötzlichen Eingebung nickte ich. Er sagte nichts, aber das Glück in seinem harten jungen Gesicht war wirklich sehenswert. Und dann, als wollte er mir beweisen, dass er keinerlei Beute bei sich trug, knöpfte er die Manschetten seines Hemdes auf und schob die Ärmel hoch. Da war keine Uhr. (Später sah ich Soldaten stolz ganze Reihen von Uhren zur Schau stellen, diese kostbaren Schätze, die sie mit nach Hause nehmen würden.) Er drehte seine Taschen um. Sie waren leer und sauber. Er hatte sie offensichtlich noch nie benutzt. Dann musste ich meine Hände in seine Stiefel stecken. Außer einem Messer in einem Seitenfach war da nichts.
Draußen hörte man barsche Schreie und Türenknallen. Er sprang auf. Ein Klaps auf die Wange, ein flüchtiger Kuss auf meine Stirn, ein strahlendes Lächeln – und er lief aus dem Zimmer.“
Diese Freundin reagierte in den Krisentagen mit der nachdenklichen Höflichkeit, die ihr zum Reflex geworden war. Es war ein undramatisches Verhalten, ein Verhalten, das nicht improvisiert werden kann. Wir wollen sehen, wie sie die Geschichte weitererzählt.
„Wir sahen zu, wie die neuen Besatzer einzogen. Während die Männer sich äußerlich nicht viel veränderten – nur war hier und da eine neue Uniform zu sehen -, sie trugen außer Haus und im Haus ihre Militärmützen, ging mit allen Frauen eine interessante Metamorphose vor, auch mit den Soldatinnen. Es waren viele. Wahrscheinlich waren sie als schwer arbeitende Landarbeiterinnen aufgewachsen – Körperbau, Hände und Füße wiesen darauf hin – und hatten in der Armee ein Leben voller Gefahren und größter Entbehrungen geführt. Aber sie waren eben Frauen mit dem Instinkt von Frauen für das Schöne.
Sie kamen in Scharen, in offenen Lastwagen, mit mürrischen Gesichtern, Stupsnasen und vollbusig. Wenn sie Zivilistinnen waren trugen sie hohe Filzstiefel und weiße Kopftücher. Hier warfen sie erste Blicke auf Frauen des Landes, zu dessen Eroberung sie beigetragen hatten. Diese Frauen waren wie meine Freundinnen und ich gekleidet, sehr einfach, ja ärmlich. Für sie jedoch war diese ordentliche Sauberkeit sehr aufregend. Hatte man ihnen nicht erzählt, hier herrschten Armut und Elend, die noch viel größer als ihre eigenen waren? Wie waren dann diese hübschen Kleider möglich: keine Löcher, keine Flicken, keine Flecken? Und sie trugen Hüte oder kleidsame kleine Turbane aus hellem Stoff auf den Köpfen? Erstaunlich. Sie wurden nachdenklich, ärgerlich, neidisch. Manch eine erschreckte Deutsche kam in diesen ersten Wochen ohne Hut nach Hause, bis ihre Befreierinnen schließlich herausfanden, dass sie diese Kleider und Hüte, die sie begehrten, für das Geld kaufen konnten, das sie bekommen hatten, aber bisher noch nicht hatten ausgeben können. Von da an wurde jeder Laden überrannt und nach einer wilden Zeit von Nachfrage ohne Bezahlung einigten sich beide Seiten auf einen steten Handel.
Einerseits war es komisch und andererseits auch ein bisschen Mitleid erregend zu sehen, wie die kräftigen Frauen und Mädchen aus den Frisiersalons kamen: Aus ihren vernachlässigten und so lange Zeit unter Soldatenmützen oder Tüchern verborgenen Haare waren nun Locken geworden. An den Füßen, die bis dahin in Stiefeln gesteckt hatten, trugen sie nun hochhackige Pumps und sie waren in Seide und Spitzen gehüllt, die sie nie zuvor auch nur von Ferne gesehen hatten. Einige dieser Frauen waren regelrechte Schönheiten geworden.
Nie hat mich der Verlust von persönlichem Eigentum weniger geschmerzt als an diesem sonnigen Maimorgen. Mein erschrockener Wirt zog mich zum Küchenfenster und machte mir Zeichen, ich solle durch den zerbrochenen Fensterladen in den Garten sehen. Polnische „Fremdarbeiter“, die von den Russen befreit worden waren, hatten den kleinen Schuppen aufgebrochen, in dem Werkzeuge und meine beiden großen Überseekoffer aufbewahrt wurden. Diese hatten sie aufgeschlitzt. Die Frauen hatten sich auf die Abendkleider gestürzt und probierten sie unter Geschrei und entzücktem Lachen an. Nie habe ich glücklichere Gesichter gesehen als die der beiden, denen es gelungen war, ein schwarzes Chiffonkleid und ein taubenblaues Spitzenkleid über den Kopf zu ziehen. Mit ihren zerarbeiteten Händen glätteten und streichelten sie den feinen Soff über ihren Hüften. Die Bewunderung in den Augen ihrer nicht weniger entzückten Landsleute, die noch abgemagert und zerlumpt in ihren mit Schweißflecken übersäten alten Kleidern dastanden, war rührend.
Vielleicht hätte ich meine Kleider zurückbekommen können. Es hätte wahrscheinlich genügt, die jungen Leute in Englisch anzusprechen, denn die Polen besitzen die besten Umgangsformen der Welt. Aber das wollte ich nicht. Ich konnte ihnen ihr Vergnügen nicht verderben. Als sie gegangen waren, ging ich hinaus. Mein kostbares Leinen lag verstreut und unberührt auf dem Fußboden des Schuppens. Sie hatten nur die nutzlose Eleganz mitgenommen. Aber vielleicht war die ja gar nicht so nutzlos. Hatte sie nicht nach Jahren unsäglicher Entbehrungen einige Menschen glücklich gemacht?“
Aus dem Buch:
Instead of cowardice or hate
COURAGE IN BOTH HANDS
Dramatic stories of real men and women who accomplished more than they believed they could
Allan A. Hunter
Copyright © 1962 by Allan A. Hunter Printed in the United States of America
BALLANTINE BOOKS, INC.
101 Fifth Avenue New York 3, N. Y.