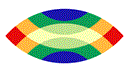Roland Vogt
Schweinrich, Kyritz-Ruppiner Heide, Kreis Ostprignitz-Ruppin/Land Brandenburg, am 23.August 2009:
„Ist das nicht ein Wunder? ruft Reinhard Lampe immer wieder in die Menge. Er zählt alle Elemente des erfolgreichen Widerstands gegen das Bombodrom auf und antwortet jedes Mal: „Ja, das ist ein Wunder!“ Ein kleiner Gospelchor auf der Bühne der Festwiese am Dranser See gibt mit einem langgezogenen „Ay-meen!“das Echo. Nach einigem Zögern stimmen mehr und mehr der über tausend Bombodrom-Gegner swingend und singend ein: „ Amen“, wahrlich so sei es.
Offensichtlich steht die Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings hier Pate. Und das passt. Eine durchdachte, gewaltfreie Strategie hat den Menschen dieser Region, einfachen Bürgerinnen und Bürgern „mit Erde an den Füßen“, einen wohlverdienten, hart erarbeiteten Erfolg geschenkt. David hat Goliath ein weiteres Mal in die Knie gezwungen. Aber es hat gedauert…
Und Schweinrich, das Dorf am Rande der Kyritz-Ruppiner Heide und am Dranser See gelegen, ist der richtige Ort, diesen Etappensieg auf dem Weg zur freien Heide zu feiern. Genau hier hatten Bombodrom-Gegner am 15 August 1992 erstmals gegen die Pläne der Bundeswehr für einen Luft-Boden-Schießplatz protestiert. Im „Dorfkrug“ dieser Gemeinde war vor genau 17 Jahren die Bürgerinitiative FREIeHEIDe gegründet worden. Und in Schweinrich war der langjährige Vorsitzende der Bürgerinitiative FREIeHEIDe, mein Freund Helmut Schönberg, Bürgermeister. Er wurde am 11. Juni 2004 im Alter von 62 Jahren jäh aus dem Leben gerissen. Möglicherweise war es eine verschleppte Grippe, die sein Herz so sehr geschwächt hatte, dass er ganz plötzlich einen Schwächeanfall erlitt und kurz danach gestorben ist. Für mich war sein Tod auch ein Symptom für den permanenten Ausnahmezustand, in dem derart aktiv Widerstand leistende Menschen leben. Dazu gehört Selbstausbeutung bis zum Gehtnichtmehr, Vernachlässigung des Privatlebens – und auch der eigenen Gesundheit.
In Schweinrich begann auch meine Beziehungsgeschichte zu dieser Region und ihren Menschen, langjährigen Weggefährten im aufrechten Gang.
Im Juni 1992 beauftragte mich der Bevollmächtigte des Brandenburger Ministerpräsidenten für den Abzug der sowjetischen Streitkräfte und Konversion, Helmut Domke, mit den Bürgermeistern der Anliegergemeinden des ehemaligen Bombodroms zwischen Wittstock, Neuruppin und Wittstock die neue Lage zu erläutern, die sich aus dem Sinneswandel des Bundesministers der Verteidigung ergab. Ich war damals als Referatsleiter für Konversion in der Staatskanzlei dem Arbeitsstab Dr. Domkes zugeordnet. Im Februar hatte das Bundeswehrkommando Ost dem für das Gebiet zuständigen Landrat Christian Gilde, auf dessen gezielte Anfrage zu Vorhaben auf der Kyritz-Ruppiner Heide noch erklärt, die Bundeswehr strebe grundsätzlich keine Übernahme von sowjetischen Liegenschaften an. Im Frühjahr 1992 sickerte durch, dass der Bundesminister der Verteidigung vielleicht doch auf dem Gelände des ehemaligen sowjetischen Bombodroms einen Luft-Boden-Schießplatz errichten wollte. Am 30. Juni war es amtlich: Der „Truppenübungsplatz Wittstock“, gemeint war besagter Luft-Boden-Schießplatz, war Teil des Truppenübungsplatzkonzepts des Verteidigungsministers Volker Rühe (CDU).
Das Treffen im Schweinricher Dorfkrug mit fast allen Bürgermeistern der Anrainergemeinden rund um das ausgedehnte Militärareal beeindruckte mich durch die Entschlossenheit der Bürgermeister, sich gemeinsam gegen das Bundeswehr-Projekt aufzulehnen. Allerdings blieb offen, was die geeignete Strategie war, um ein derart folgenreiches Vorhaben der Bundesregierung abzuwenden.
Auf der Rückfahrt von dieser denkwürdigen Dienstreise reifte in mir der Entschluss, dienstlich und in meiner Freizeit alles mir Mögliche zu tun, um das deutsche Nachfolgeprojekt des sowjetischen Bombodroms zu Fall zu bringen.
Schweinrich, 5. August 1992: Im brechend vollen Großen Saal des Dorfkrugs winden sich Offiziere der Bundeswehr, um einer aufgebrachten, widerspenstigen Menschenmenge die Segnungen und die Harmlosigkeit des geplanten Luft-Boden-Schießplatzes nahezubringen: Investitionen in Millionenhöhe, um das von den sowjetischen Streitkräften hinterlassene Bombodrom von Munition zu befreien. Soldaten, vielleicht eine Garnison in Wittstock, die Kaufkraft in die Region bringen, Offiziere, die für ihre Familien Häuser bauen oder mieten.
Schießübungen am Boden und aus der Luft ja, aber soft und selten, keineswegs so laut und rücksichtslos wie das die Rote Armee gemacht habe…
Die Menschen im Saal lassen sich nicht beeindrucken. Sie sind vor allem aufgebracht, dass die Bundeswehrführung erst erklärt hat an ehemaligen sowjetischen Übungsplätzen kein Interesse zu haben und nun doch auf das Bombodrom-Gelände will.
Martina Rassmann meldet sich energisch zu Wort: „ Wir haben darauf vertraut, dass die Bomberei mit dem Abzug der russischen Streitkräfte endgültig vorbei ist. Nur deshalb haben wir, mein Mann und ich, gewagt, ein ehemaliges Betriebsferiengelände zu übernehmen, um damit für unsere Familie eine neue Existenz aufzubauen. Der Platz ist in Kagar, auf der anderen Seite des Bombodroms, ganz nah beim Großen und Kleinen Zermitten-See und auch nicht weit vom Dolgow-See. Wir wollen dort einen modernen attraktiven Campingplatz einrichten. Aber seit bekannt ist, dass die Bundeswehr doch wieder bomben will, ist keine Bank in der Region bereit, uns einen Kredit zu geben. Ein Feriengast vermittelte mir schließlich einen Kredit einer Frankfurter Bank von zunächst einer Million Deutsche Mark. Familienmitglieder und Freunde leisten dafür Bürgschaft. Wenn Sie nun mit Ihren Tieffliegern kommen, Raketen auf das Bombodrom abschießen und Bomben werfen, bleiben unsere Gäste weg. Und andere kommen erst gar nicht. Dann sind wir erledigt. Wir können den Kredit nicht zurückzahlen. Wie soll ich unseren Bürgen dann noch in die Augen sehen? Und meine Familie geht pleite. Ich hab keine ruhige Nacht mehr.“ Betroffenheit und lang anhaltender Applaus. Den Bundeswehrvertretern fällt nichts mehr ein.
Die Argumentation von Martina Rassmann lässt mich aufhorchen. Wenn es mehreren Unternehmerinnen und Unternehmern in der Region genauso ergeht wie ihr und ihrer Familie, ist ernsthafter und dauerhafter Widerstand gegen das Bundeswehrprojekt möglich. Allerdings nur, wenn die Betroffenen etwas wagen, zum Beispiel ihre Zwangslage öffentlich zu machen.
Genau so war es doch auch im Larzac, im südfranzösischen Okzitanien, wo ich im Sommer 1974 miterlebte, wie phantasievoll die Einheimischen sich gegen die massive Ausweitung eines Truppenübungsplatzes wehrten, weil das ihre Existenz zerstört hätte. Und so war es auch in Wyhl am Kaiserstuhl ab 1974/75, wo sich die Menschen in ihrer angestammten Lebensweise und ihrer wirtschaftlichen Existenz durch ein geplantes Atomkraftwerk bedroht fühlten. In beiden Fällen führten Strategien gewaltfreien Widerstands und die Bereitschaft zum zivilen Ungehorsam zum Erfolg.
Info 1 - Larzac:
Im Larzac, einer Hochebene hundert Kilometer nördlich von Montpellier, wollte die französische Regierung in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Truppenübungsplatz erheblich erweitern. Die Region lag einigen Leserinnen und Lesern vielleicht schon einmal auf der Zunge:in Gestalt des würzigen Roquefort-Käses.Er wird aus Schafsmilch gewonnen und in Höhlen des Berges Combalon nahe dem Ort Roquefort zum Reifen gebracht.Durch die Pläne der Zentralregierung, die auf Enteignung der Felder und des Weidegeländeshinausliefen, fühlten sich die Farmer in ihrer Existenz bedroht. Einige schon zum zweiten Mal in ihrem Leben. Hatten sie doch nach der Unabhängigkeit Algeriens dort ihre Farm verloren und sich im Larzac eine neue Existenz aufgebaut.Inspiriert durch Lanza del Vasto, der eine Zeit lang Mitstreiter Gandhis in Indien war und nach dem Zweiten Weltkrieg in Südfrankreich die Gemeinschaft der Arche gestiftet hatte, entwickelte die verschworene Gemeinschaft von 103 Farmern eine mit bäuerlicher List gepaarte, gewaltfreie Widerstandsstrategie. Ganz Frankreich lachte über die Schafe aus dem Larzac, die , bei Nacht und Nebel nach Paris verfrachtet , auf dem Marsfeld unter dem Eiffelturm grasten. Die Hauptstadt-Polizisten hatten ihre liebe Not mit den dort nicht vorgesehenen Viechern, derweil die Larzac-Bauern in den umliegenden Bistros saßen und sich ins Fäustchen lachten. Die Medien hatten eine gute Story und verhalfen dem Kampf des Larzac zu landesweiter und internationaler Aufmerksamkeit und Sympathie. Das Hochplateau des Larzac wurde schließlich im Sommer 1974 zu einer Pilgerstätte für Hunderttausende von Franzosen und anderen Westeuropäern, viele auf der Suche nach alternativen Lebens – und Gesellschaftsentwürfen. Die Aktionen der Larzacbauern und ihrer Verbündeten waren fantasievoll, witzig und tiefgründig. Sie pflügten Felder um, die bereits durch die Zentralregierung enteignet worden waren, säten und ernteten darauf Getreide. Das waren zwar Akte des zivilen Ungehorsams aber die Polizei wagte nicht dagegen vorzugehen, nachdem der Widerstand des Larzac bereits zur nationalen Legende geworden war.An ihr kam niemand vorbei, der im links-alternativen Lager was werden wollte – auch eine Art von Machtentfaltung. So hielt es der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, Francois Mitterand, für ratsam auf dem Hochplateau des Larzac zu erscheinen und zu versprechen als Präsident die Militärpläne zu stoppen.Und er hat Wort gehalten. Für ihn war das – anders als später bei Scharping in der Kyritz-Ruppiner Heide- eine Frage der Ehre. Am 10. Mai 1981 wurde Mitterand zum Präsidenten gewählt, am 3 .Juni 1981 bestätigte die neue Regierung Mauroy offiziell den Verzicht der Republique Francaise auf das Erweiterungsprojekt.�Info 2 - Widerstand gegen das Atomkraftwerk WYHL am Kaiserstuhl:
Das Badenwerk, ein machtvolles Energieversorgungsunternehmen, wollte in der Rheintalgemeinde Wyhl am Kaiserstuhl ein Atomkraftwerk errichten. Anfang 1975 war ein Teil des Auewaldes schon gerodet, die Baumaschinen standen bereit. Das Komitee der badisch-elsässischen Bürgerinitiativen rief zum gewaltfreien Widerstand auf. Eine neun Monate andauernde Bauplatzbesetzung führte schließlich zum Nachgeben der Betreiber und der Landesregierung von Baden-Württemberg. Ministerpräsident Filbinger hatte noch im Februar 1975 prophezeit: „Wenn Wyhl nicht gebaut wird, gehen in Baden-Württemberg die Lichter aus“. Nun aber sah sich seine Landesregierung genötigt, alle Aktionen des zivilen Ungehorsams straffrei zu stellen. Außerdem wirkte die Landesregierung auf das Badenwerk und seine Subunternehmer ein, auf eventuelle Schadensersatzansprüche gegen die Akteure des Widerstandes zu verzichten.Der Nährboden des lang anhaltenden Widerstands war auch im Fall Wyhl die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz. Durch die Kühlturmnebel des Atomkraftwerks hätte sich das Kleinklima im umliegenden Weinbaugebiet erheblich verschlechtert. Der Wein, Wirtschaftsgrundlage der Kaiserstühler, wäre nicht mehr als „von der Sonne verwöhnt“ –so der Werbeslogan der Winzerschaft - vermarktbar gewesen.Als starke Antriebskraft kam die Sorge um Gesundheit und Leben hinzu. Im Nahbereich atomarer Anlagen nimmt die Krebshäufigkeit , insbesondere Leukämie bei Kindern, zu, was auf die regelmäßige Niedrigstrahlung und ihre Anreicherung über die Nahrungskette im Körper zurückgeführt wird. Beide Motive erklären die Hartnäckigkeit und Unbeugsamkeit des Widerstands einer ganzen Region. Die Alemannen im „Dreyecksland“ Elsass, Baden und Schweiz trotzten im frostklirrenden Februar 1975 Wasserwerfern, ließen sich von Strafverfolgung und Disziplinarmaßnahmen nicht beeindrucken. Sie schufen eine Widerstandskultur ohnegleichen, knüpften an regionale Traditionen an. Widerstandslieder wurden in der Muttersprache „Muodersproch“, der Alemannen gesungen. Die Grenzbevölkerung begann, ihr Dreyecksland als eigenständige europäische Region zu begreifen, die einen gemeinsamen Abwehrkampf gegen gefährliche industrielle Großprojekte und für ihre bisherige Lebensweise führte. Der Widerstand brachte neuartige Institutionen hervor wie die Volkshochschule Wyhler Wald und Radio Dreyecksland. Es dauerte nicht lange, bis heimische Erfinder nach ersten tastenden Versuchen Anlagen Erneuerbarer Energien den Weg ebneten.Am Ende der Versammlung spreche ich Frau Rassmann an: Ob ich die kommenden Nächte auf ihrem Feriengelände verbringen könnte? Und ob sie mich dann vielleicht gleich dorthin lotsen würde? „Kein Problem“, sagt sie. Doch habe ich einen Hintergedanken – und frage sogleich, ob sie einen Menschen kenne, dem die Leute hier vertrauen. Ich suche jemanden aus der Region, der bereit ist, die Initiative zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen die Pläne der Bundeswehr zu ergreifen. Sie überlegt nicht lange und sagt: „Fragen Sie mal den Pfarrer Lampe in Dorf Zechlin“. In stockfinsterer Nacht fahren wir im Konvoi zum Bombodrom-Gelände. Mir wird mulmig, denn meine Gönnerin steuert auf einen Kontrollposten der sowjetischen Streitkräfte zu. Plaudert ein wenig mit den Soldaten, die dort Wache schieben, gibt ihnen eine Schachtel Zigarettern – und die lassen uns einfach passieren! Wir fahren quer durchs Bombodrom und kommen auf der anderen Seite unbehelligt von weiteren Kontrollen raus – und gleich sind wir in Kagar auf dem Campingplatz Reiherholz. Meine Gastgeberin quartiert mich zum Freundschaftspreis in einer Ferienwohnung ein.
Am nächsten Morgen mache ich mich auf zum Pfarrhaus im nahegelegenen Dorf Zechlin, denn da soll Pfarrer Lampe wohnen. Es ist der 6. August, Hiroshimagedenktag. Da faste ich jedes Jahr bis zum 9. August, dem Tag, als 1945 über Nagasaki die zweite Atombombe abgeworfen worden ist. 1983 habe ich an den Gedenkfeiern in beiden Städten teilgenommen und die Spätfolgenopfer der Atombombenabwürfe, die Hibakushas, besucht. Sie haben meist keine Angehörigen mehr und siechen in Krankenhäusern dahin.
Diesmal widme ich das Fasten der Kyritz-Ruppiner Heide und dem Wunsch, sie möge vom Bombenabwurftrainig verschont bleiben. Der gestrige Abend hat mir noch einmal klargemacht was zu tun ist.
Pfarrer Lampe öffnet auf mein Klingeln. Ich trage ihm mein Begehren vor und er sagt, ich solle am Nachmittag wiederkommen. Die Pause nutze ich, um die Seenlandschaft bei Kagar zu erkunden. Der nächstgelegene Große Zermittensee hat einen weiten Sandstrand sowie Turn- und Spielgeräte. Als ich gegen halb elf ankomme, bin ich der einzige Badegast.
Um 11 Uhr lässt sich ein älteres Paar am Strand nieder. Etwas später kommt eine junge Familie mit Kindern. Vom ersten ausgedehnten Schwimmen zurück am Strand und meiner nassen Badehose überdrüssig entdecke ich einen Wegweiser zum Nacktbadestrand. Der liegt am Kleinen Zermittensee. Ja, bin ich denn im Paradies? Vor mir liegt ein wunderschöner kleiner See mit rundum intaktem Schilfgürtel. Außer mir keine Menschenseele. Auch die Enten nehmen keinen Anstoß an einem nackten Mann mit Bart. So statte ich den Seerosen einen Höflichkeitsbeschwimm ab. Entdecke ein halbhavariertes anscheinend herrenloses Boot, mit dem ich den See umrunden kann. Nachdem ich das Boot mit dankbaren Gefühlen für den Überlasser wieder vertäut habe, sammle ich meine Habseligkeiten und die inzwischen getrocknete Badehose am Großen Zermittensee ein und begebe mich erneut mit noch größerer Entschlossenheit nach Dorf Zechlin . Diese paradiesische Erholungslandschaft darf keinem Übungsterror ausgesetzt werden. Nun geht es darum beim Pfarrer Lampe den ersten Versuch zu machen, Menschen der Region für eine gewaltfreie Widerstandsstrategie zu gewinnen. Schließlich haben mir die Bauern des Larzac und die Winzer vom Kaiserstuhl gezeigt, wie es geht. Das Gedenken an die Opfer der ersten Atombombenabwürfe spornt mich zusätzlich an.
Doch wie weit darf ich gehen bei Pfarrer Lampe?
Auf jeden Fall nehme ich Wolfgang Hertles Fallstudie zum Larzac mit. Darin wird mit großer Einfühlungsgabe und Sachkunde die gewaltfreie Strategie geschildert, die dort zum Erfolg geführt hat (siehe Infokasten 1). Wenn ich das Buch überreiche, brauche ich nicht so viel zu erzählen und kann mich auf das Wesentliche konzentrieren.
Wie meine Botschaft ankam, schildert Friederike Lampe, Ehefrau von Reinhard Lampe im Buch der Bürgerinitiative FREIeHEIDe (im Jahr 2000 veröffentlicht und inzwischen vergriffen):
„Wir saßen zu dritt in der Küche – Roland Vogt, Reinhard Lampe und ich. Nach der ersten Versammlung in Schweinrich forderte Herr Vogt Reinhard eindringlich auf, eine Bürgerinitiative zu gründen. Er sei der richtige Mann dafür und eine Bürgerinitiative die einzige Chance, das Unheil abzuwenden. Wir ahnten, was das für uns bedeuten würde. Wir waren noch ausgelaugt von Gründungsaktivitäten einer anderen Initiative. Und der ganz normale Alltag forderte uns auch ausreichend. Reinhard ließ sich dennoch überzeugen“(Die andere Initiative, auf die Friederike Lampe Bezug nimmt: Ehepaar Lampe wollte das märkische Pflaster in Dorf Zechlin erhalten wissen, aber schließlich setzte sich die Autofahrerfraktion durch. Woraufhin der Pflasterstrand aus dem märkischen Dorf verschwand).
Noch in der Versammlung am 5. August in Schweinrich war zu einer Protestversammlung am 15. August am Dranser See aufgerufen worden. Ich schlug Reinhard Lampe vor, als Redner Theodor Ebert, den Nestor der gewaltfreien Aktionsbewegung in Deutschland, einzuladen. Der Friedensforscher Ebert könne am ehesten vermitteln, was alles zu einer erfolgreichen, gewaltfreien Strategie gehöre. Außerdem sei er Professor an der Freien Universität Berlin, werde wahrscheinlich kein Honorar verlangen und habe keinen allzu weiten Weg in die Kyritz-Ruppiner Heide. Ebert habe auch Erfahrungen mit Bürgerinitiativen. Doch es sei unabdingbar, dass er, Reinhard Lampe, persönlich bei der Versammlung am 15. August die Initiative ergreife, zur Gründung einer Bürgerinitiative aufrufe und sich dann die Namen derjenigen aufschreibe, die mitmachen wollten.
Mein Freund Theo Ebert kam und machte den Menschen Mut zum Widerstand, ließ aber keinen Zweifel daran, dass eine gewaltfreie Strategie einen langen Atem erfordere. Es könne durchaus sein, dass man sich auf 10 Jahre anstrengenden Widerstands einstellen müsse. Am Beispiel des Larzac zeigte er, dass Erfolg möglich ist, wenn alle Aktionen strikt gewaltfrei bleiben und es gelinge, die Sympathien von Bevölkerung und Entscheidungsträgern zu gewinnen.
Reinhard Lampes Aufruf, eine Bürgerinitiative zu gründen, fiel auf fruchtbaren Boden. Etwa 30 der am Dranser See Protestierenden erklärten sich bereit, aktiv mitzumachen.
Unter den an der Gründung der Bürgerinitiative am 23. August im Dorfkrug zu Schweinrich Beteiligten waren mehrere für die Aufgabe geeignete Führungspersönlichkeiten. Um nur einige prägende Gestalten zu nennen: der eingangs schon vorgestellte ehrenamtliche Bürgermeister von Schweinrich, Helmut Schönberg, Pfarrer Benedikt Schirge, bis heute Sprecher und in der öffentlichen Wahrnehmung „das Gesicht der FREIenHEIDe“ und die –in- zwischen verstorbene- Annemarie Friedrich, eine ehemalige Oberschullehrerin aus der Region. Sie ging als die „Großmutter der FREIenHEIDe“ in die Annalen des Widerstands ein.
Die Bürgerinitiative oder etwas Ähnliches wäre wahrscheinlich auch ohne mein Einwirken zustande gekommen. Sehr viele Menschen in der Region suchten nach Methoden, ihre Ablehnung der Neuauflage des neuen, nun deutschen Bombodroms wirksam werden zu lassen. Sie vertrauten den Ortsbürgermeistern, die in ihrer Mehrheit bereits öffentlich ihre Entschlossenheit erklärt hatten, gegen die Bundeswehrpläne vorzugehen. Auch der Wittstocker Landrat Gilde, zugleich Landtagsabgeordneter der SPD, bezog entschieden Position gegen das Bundeswehrprojekt. Doch als Landrat hätte er leicht in Schwierigkeiten geraten können, wenn er protestierenden Mitbürgern zugleich als Sympathisant des Widerstands und als Sachwalter der öffentlichen Ordnung begegnet wäre. Mir war von Anfang an klar, dass beim zweistufigen Aufbau der Landesverwaltung in Brandenburg, wo es keine Regierungspräsidien als Vollstrecker der Landeshoheit gibt, Landräte und Bürgermeister in konkreten Widerstandssituationen Loyalitätskonflikte auszustehen haben würden, die auch bei höchster Integrität der handelnden Persönlichkeiten zum Hemmnis für den Bürgerwiderstand hätten werden können. Christian Gilde sah das genau so und war froh und erleichtert darüber, dass mit der Bürgerinitiative ein neuer Akteur die Bühne betrat.
Die Bürgerinitiative FREIeHEIDe
1.Ein Drehbuch für die Protestwanderungen
Nachdem Reinhard Lampe für die Idee der Gründung einer Bürgerinitiative gewonnen war, ging er gemeinsam mit seiner Ehefrau Friederike, von Beruf Psychotherapeutin, ans Werk. Mich hatte das Paar schon bei der ersten Begegnung stark beeindruckt. Die beiden sind Eltern von zwei reizenden Mädchen, die bei meinem überfallartigen Besuch im Garten spielten und hin und wieder in der besagten Küche aufkreuzten. Positiv berührte mich, dass Reinhard nicht gleich zusagte, die ihm angetragene Rolle zu übernehmen, sondern dass er sich erst einer gemeinsamen Entscheidung mit Friederike vergewissern wollte. Das Ehepaar Lampe war, wie sich herausstellen sollte, ein Glücksfall in der Gründungsphase der Bürgerinitiative.
Aber lassen wir Friederike Lampe selbst zu Wort kommen:
„… Nun ging die gedankliche Vorbereitung los. Tagelang haben wir über den Namen nachgegrübelt. Freunde einbezogen, bis Reinhard den Geistesblitz FREIeHEIDe hatte. Und mich hatte es auch gepackt. Das könnte ja eine tolle Sache werden, wenn wir – die potentiell Gleichgesinnten – Spaß miteinander hatten und wenn wir eine Struktur fänden, die dann eine Eigendynamik entwickelte. … Was ich nicht wollte, war ein bedeutungsschweres, humorloses, fanatisches, kämpferisches „Nun zeigen wir es denen mal“. Und dazu gehört für mich auch die Sprachkultur jenseits von „Demo“ und Marschieren… Ich stellte mir immer wieder die Frage, wofür anstelle wogegen wir aktiv werden. Und da fiel uns – übrigens während eines Spazierganges!- eine ganze Menge ein: Wir haben diesen Schatz einer wunderschönen Landschaft, also warum nicht beim miteinander Gehen und Wandern uns dessen erfreuen?Und wir haben Dörfer mit ihrem jeweils eigenen Charakter, mit ihren von den Vorfahren teilweise selbst erbauten Kirchen (meist Feldsteinkirchen; Anm. d. Verf.). Und dort ist ein guter Ort für den Beginn. Ein Ort zum Musizieren, für gute Gedanken, für Informationen und- für alle, die es wollen- ein Ort für den Segen. Also, wie wäre es, wenn wir uns am immer gleichen Sonntag im Monat in der jeweiligen Kirche versammelten und von dort aus zur Schießplatzgrenze wanderten? Ringsherum? Und, wenn nötig, nach einem Jahr wieder beim Ausgangsdorf anfingen? Damit war das Motto klar:
Auf dem Weg zur FREIenHEIDe.(Hervorhebung durch d. Verf.)
Und die Schießplatzgrenze konnte doch ein Ort werden, wo wir unsere Lebensfreude spüren, tanzen zum Beispiel. Und wir sollten ein sichtbares dauerhaftes Zeichen setzen…Wir haben Holz, Bäume. Also warum nicht jedes Mal eine Mahnsäule errichten?“Das von den Lampes entwickelte Konzept überzeugte die Mitglieder der Bürgerinitiative in Gründung und wurde fortan zum verbindlichen Muster der Protestwanderungen.
Bei der Gründungsversammlung am 23. August 1992 konnten schon Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der ersten Protestwanderung gebildet werden. Sie fand am Sonntag, dem 13. September, in Dorf Zechlin statt und Reinhard Lampe hielt die erste Andacht für die FREIeHEIDe in seiner Kirche. Mit seiner mitreißenden Andacht am 23. August 2009 am Dranser See schloss sich für viele von uns der Kreis nach 113 Protestwanderungen.
2. Grundlagen eines lang andauernden zivilen Widerstands
Wie konnte es gelingen, dass einfache Bürgerinnen und Bürger in einer dünn besiedelten Region 17 Jahre lang ihre Heimat gewaltfrei und schließlich erfolgreich gegen ein Großprojekt des Staates zu verteidigen wussten? Dass sie Macht entfalteten? Denn wenn Macht die Fähigkeit ist, einen Anderen auch gegen seinen Willen zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zu bewegen, dann haben die Bürgerinitiative FREIeHEIDe und ihre Bündnispartner Macht ausgeübt.
Allein, dass die Luftwaffe so lange gehindert wurde, das Vernichten von Bodenzielen zu üben, ist schon ein Achtungserfolg.
Gekrönt aber wird der Erfolg, als der Bundesminister der Verteidigung, Franz Josef Jung, am 9. Juli 2009 auf einer Pressekonferenz verkündet, „ … dass die Bundeswehr auf die Nutzung von Wittstock als Luft-Boden-Schießplatz verzichten wird“ (genauer Wortlaut siehe Info-Kasten 3)
Info 3 - Originalton Jung am 9. Juli 2009, flankiert vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Schneiderhahn, vor der Presse:
„Wir haben hier sehr sorgfältig die Erfolgsaussichten überprüft, aber natürlich auch die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft unserer Luftwaffe. Und in diesem gesamten Abwägungsprozess kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Bundeswehr auf die Nutzung von Wittstock als Luft-Boden-Schießplatz verzichten wird, das heißt keine Revision gegen dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin/Brandenburg einlegen wird… Wir sind auch der Auffassung, dass nach 15 Jahren auch der gerichtlichen Auseinandersetzung , damit verbunden auch der Nichtnutzung des Luft-Boden-Schießplatzes Wittstock durch die Bundeswehr und auch unter Berücksichtigung der Petitionsentscheidung des deutschen Bundestages eine Realisierung des Luft-Boden-Schießplatzes Wittstock nicht mehr möglich ist… “ (Anm. d.Verf.: Mit „Wittstock“ oder „Luft-Boden-Schießplatz Wittstock“ ist das 142 Quadratkilometer große Areal in der Kyritz-Ruppiner Heide zwischen den Städten Wittstock, Neuruppin und Rheinsberg gemeint. Die Bundeswehr nannte ihr Vorhaben Luft-Boden-Schießplatz, die Gegner dieses Unterfangens sprachen in Anlehnung an den früheren sowjetischen Bombenabwurfplatz meist vom Bombodrom)
Für das lange Durchhaltevermögen der FREIeHEIDe-Bewegung und den schließlich erreichten Verzicht des Bundesministers der Verteidigung auf einen Luft-Boden-Schießplatz in dieser Region waren mehrere Komponenten maßgebend:
- ein klares Ziel;
- der unerschütterliche Glaube der Akteure des Widerstands, dass dieses Ziel erreichbar ist ;-eine gekonnte gewaltfreie Strategie;
-Inspiration, Führung und Integration durch Persönlichkeiten natürlicher Autorität;
-eine verlässliche Kerngruppe, die für das Gelingen der Protestwanderungen und anderer Aktionen verantwortlich zeichnete;
-spektakuläre Bilder, mit denen die FREIeHEIDe immer wieder in die Medien kam, etwa wenn Tausende Teilnehmer gemeinsam das Peace-Zeichen bildeten;
-die Fähigkeit , das Protestwandern an Ostern zum größten Ostermarsch in Deutschland anwachsen zu lassen;
-das Wecken großer Spendenbereitschaft von Sympathisantinnen und Sympathisanten überall in Deutschland,
-das Gewinnen von Bündnispartnern in allen Schichten der Bevölkerung und länderübergreifend, wovon Initiativen wie die Unternehmerinitiative „pro Heide“ und die Mecklenburger Initiative „Freier Himmel“ Zeugnis ablegen;
- und letztlich ist nicht auszuschließen, dass die Ankündigung massenhaften zivilen Ungehorsams durch die Kampagne „Bomben nein-wir gehen rein“ Eindruck auf Entscheidungsträger gemacht hat. Im Rahmen dieser Kampagne hatten sich 2000 Menschen durch Unterschrift bereiterklärt, bei Übungsbeginn ins Bombodrom-Gelände einzudringen. Dadurch, so die Einschätzung der Initiatorinnen und Initiatoren, wurde dokumentiert, dass selbst im Fall einer juristischen Niederlage die Bewegung nicht resigniert. Vielmehr hätte der Widerstand mit gewaltfreiem zivilem Ungehorsam eine neue Qualität bekommen.
Das Geheimnis des Erfolgs wird wohl im Zusammenwirken all dieser Faktoren liegen oder, anders gesagt: in der Fähigkeit der Widerstandsbewegung, alle verfügbaren Register gewaltfreien Handelns zu ziehen.
Garanten des Erfolgs: Erstklassige Verwaltungsrechts-Anwälte und richterliche Rechtsfortbildung
Ganz entscheidend jedoch sowohl für das lange Durchhalten als auch für den Erfolg nach 17 Jahren Widerstand war der Einsatz exzellenter Anwälte für die Sache des Widerstands. Auf meine Empfehlung hatte Christian Gilde den Berliner Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Reiner Geulen, dafür gewinnen können, das Mandat für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu übernehmen. Geulen war mir in den 1970er Jahren aufgefallen, als er der Bürgerinitiative für die Erhaltung des Spandauer Forsts geholfen hat, ein Kohlekraftwerk zu verhindern. Am 27. Januar 1994 erhebt Rechtsanwalt Reiner Geulen im Namen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, der Gemeinden Gadow und Schweinrich, der Kirchengemeinde Dorf Zechlin und dreier betroffener Grundstückseigentümer vor dem Verwaltungsgericht Potsdam Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel, die Weiternutzung des ehemaligen russischen Bombenabwurfplatzes durch die Bundeswehr zu untersagen. Geulen gewinnt schließlich im Fall der Kyritz-Ruppiner Heide, gemeinsam mit seinem mittlerweile hinzugewonnenen Sozius Remo Klinger, sage und schreibe 27 Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Inzwischen haben sich die beiden Anwälte den Ruf erworben, mit geradezu magischer Fähigkeit Prozesse gegen umweltschädliche und unsinnige Projekte zu gewinnen. Eines der Geheimnisse ihres Erfolges ist, dass sie mit untrüglichem Spürsinn die Fehler und Schwächen in den Planungen der Gegenseite aufdecken. Im Fall der Kyritz-Ruppiner Heide hat ihnen nicht zuletzt die Arroganz von Bundeswehrjuristen in die Hände gespielt, die partout nicht einsehen wollten, dass auch die militärische Seite sich nicht über die Beteiligungsrechte betroffener Bürger und Gemeinden hinwegsetzen darf. Während der gesamten Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzungen hatte ich die Sorge, dass alle vier Minister der Verteidigung sich auf der sicheren Seite wähnten, weil es nach Entspannung, Wende und Vereinigung politisch versäumt worden war, die das Militär privilegierende Rechtsordnung aus der Zeit des Kalten Krieges an die neue Weltlage anzupassen. Geulen und Klinger ist hoch anzurechnen, dass sie solche Zweifel nie an sich herangelassen haben, unerschütterlich an den Erfolg glaubten und mit dieser Zuversicht sowohl die Menschen im Widerstand angesteckt als auch die Richterinnen und Richter überzeugt haben.
Die Lehre für alle, die vergleichbare Probleme zu lösen haben, ist: Nehmt nicht irgendwelche Anwälte, sondern die besten und sorgt dafür, dass Ihr sie auch bezahlen könnt!
Und die Botschaft mag –frei nach dem Ausspruch des Müllers von Sanssouci- lauten: Es gibt noch Richter in Berlin und Brandenburg!
3. Lernen im Widerstand
Wie und wo lernen Menschen? Gewiss: in der Familie, auf der Straße, in Schule, Universität, und Berufsausbildung und schließlich in der Arbeitswelt, wenn dafür die Chance geboten wird. Sicher auch lebenslang, von der Kindheit bis ins Greisenalter. Rasant beschleunigt wird aber, so finde ich, das Lernen bisweilen durch die Agentur der Liebe und die Agentur des Widerstands. Gemeinsam ist beiden, dass es sich um Ausnahmezustände handelt. Vom Lernen in der Liebe soll hier nicht berichtet werden. Aber vom Lernen im Widerstand. Im Larzac und in Wyhl, erst recht aber in der Kyritz-Ruppiner Heide, hat sich gezeigt: Die aktive Teilnahme an dieser Art von Widerstand beschleunigt das Lernen enorm. Das, was in kurzer Zeit über Demokratie und Rechtstaat erfahren wurde, hätte in dieser Intensität auf keiner juristischen oder politologischen Fakultät gelernt werden können, auch nicht auf der Ochsentour in einer Partei. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR hatte das –so kurz nach der Vereinigung!- eine besondere Bewandtnis, weil die Gewährleistungen und die Institutionen westlicher Demokratien für Viele Neuland waren, für manche mit hohen Erwartungen, für andere mit großer Skepsis verbunden.
Doch als es um Selbstbehauptung angesichts der Bedrohung von außen ging, waren die Sinne aller am Widerstand Beteiligter geschärft genug, um die Möglichkeiten und Grenzen der bundesdeutschen Rechtsordnung und der repräsentativen Demokratie rasant schnell zu erkennen.
Das Besondere an der FREIenHEIDe im Vergleich zu den Fallstudien aus dem Westen ist, dass einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter Erfahrungen mit dem durch Macht von unten erzwungenen Systemwandel einbringen konnten.
Reinhard Lampe zum Beispiel hat vor der Wende „Demokratie Jetzt“ mit initiiert und tat sich bereits 1986 als junger Vikar durch systemkritische Aktivitäten hervor.
Aber sie lernten auch schmerzlich, dass auf die große Politik kein Verlass ist. Dafür stehen die Namen Rudolf Scharping und Peter Struck. Der eine versprach als Kanzlerkandidat, der andere als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, dass, sobald ihre Partei im Bund regiere, das Projekt Luft-Boden-Schießplatz gestoppt und die Kyritz-Ruppiner Heide für die zivile Nutzung freigegeben werde.
Durch einen wahrhaft teuflischen Schachzug des Schicksals wurden beide Politiker nacheinander Verteidigungsminister und setzten sich fortan mit aller Härte für das Projekt ihres Amtsvorgängers Rühe (CDU) ein.
Auch das Vertrauen der Landeskinder Brandenburgs in das Wort des jeweiligen Landesvaters und einiger Minister wurde arg strapaziert. Die SPD führt seit Neugründung des Landes Brandenburg ununterbrochen die Regierung an. Eindeutig gegen den Luft-Boden-Schießplatz verhielt sie sich nur in der Ampelkoalition während der ersten Legislaturperiode. Als sie dann allein regieren konnte, verschanzte sie sich hinter dem Argument, durch Stellungnahmen als Regierung nicht in laufende Gerichtsverfahren eingreifen zu wollen. In der dann folgenden großen Koalition nahm sie hinter der CDU des ehemaligen Generals und Staatssekretärs beim Bundesminister der Verteidigung, Jörg Schönbohm, Deckung.
Kleines Wunder durch Zivilcourage im Amte
Erst im Landtagswahljahr 2004 kam auf erstaunliche Weise Bewegung ins Spiel. Wahltag war der 19. September. Im April brachte die Unternehmerinitiative Pro Heide eine Sensation zustande: Sie überzeugte Ulrich Junghanns, den CDU- Wirtschaftsminister der Brandenburger großen Koalition, davon, dass ein Luft-Boden-Schießplatz inmitten der seen- und waldreichen Erholungsregion die aufstrebende Tourismusbranche beschädigt und allein schon die Aussicht auf das Bundeswehrprojekt ein Investitionshemmnis ist. Junghanns vollzog daraufhin einen Kurswechsel im Wirtschaftsministerium, das zuvor bei einer Anhörung - im Rahmen eines der Bundeswehr vom Verwaltungsgericht auferlegten Beteiligungsverfahrens - den Luft-Boden-Schießplatz „mit Nachdruck“ begrüßt hatte, weil es ihn für einen bedeutsamen Wirtschaftsfaktor in einer strukturschwachen Gegend hielt. Meine Gegenvorstellungen als seit Jahren mit der Kyritz-Ruppiner Heide befasster Konversionsbeauftragter im Wirtschaftsministerium waren auf dem hierarchischen Dienstweg niedergebügelt worden.
Mit seinem Kurswechsel als Fachminister gab Junghanns auch der Landes-CDU das Signal zum Umdenken. Zugleich befreite er Brandenburgs SPD zu sich selbst. Unter dem Druck des nahen Wahltermins ließ sie sogar die Rücksicht auf die Position ihres Genossen Struck fahren und schlug sich voll auf die Seite der Bombodrom-Gegner.
Seitdem gab es einen edlen Wettstreit der wahlkämpfenden Landesparteien um die Gunst der regionalen Bevölkerung, die ihrer Ablehnung des Luft-Boden-Schießplatzes im April 2004 durch 10.000 Demonstranten in der Fontane-Stadt Neuruppin Nachdruck verlieh.
Vor der Landtagswahl beschloss der brandenburgische Landtag auf Antrag von SPD und CDU auf Bundesebene gegen die Einrichtung des Luft-Boden-Schießplatzes vorgehen zu wollen.
Nach der Wahl bezog die erneuerte Regierung aus SPD und CDU in ihrer Koalitionsvereinbarung Stellung gegen den „ehemaligen“ (!) Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide.
Der von Junghanns herbeigeführte Kurswechsel und die von ihm ausgelöste Dynamik galten damals schon als kleines Wunder, weil niemand damit gerechnet hatte. Bemerkenswert daran ist, dass Junghanns damit auch seine politische Karriere riskierte und so ein Beispiel der in Deutschland so seltenen Zivilcourage im Amte gab.
Info 4 - „Zivilcourage“:
Der Begriff Zivilcourage wird Otto von Bismarck als Wortschöpfung zugeschrieben. 1864 soll er, wie von Keudell 1901 schreibt, aus Enttäuschung über einen Verwandten, der ihn im Reichstag nicht unterstützt hat, gesagt haben: „Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt“. Nachgewiesen wird der Begriff erstmals in Frankreich als „courage civil“, Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil, und „courage civique“, staatsbürgerlicher Mut. Der deutsche Begriff Zivilcourage umfasst beides. In vielen anderen Sprachen kommt der Begriff nicht vor. So hat John F. Kennedy seine Studie über Persönlichkeiten der US-amerikanischen Geschichte, die sich durch Zivilcourage ausgezeichnet hatten, „On the Courage“ genannt. Das Wort Zivilcourage stand ihm im Englischen nicht zur Verfügung.
Durchbruch auf Bundesebene
Sosehr die Brandenburger Wende den Bombodrom - Gegnern neuen Auftrieb gab, auf der großpolitischen Ebene bedeutete sie noch nicht viel. Der jeweilige Bundesminister der Verteidigung wartete auf den Ausgang der Gerichtsentscheidungen und meinte dabei die besseren Karten zu haben. Dabei konnte er auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vertrauen, das im Dezember 2000 der Bundeswehr zwar bis auf weiteres den Übungsbetrieb untersagt hatte, die Übernahme des sowjetischen Übungsplatzes durch die Bundeswehr aber gleichwohl für rechtmäßig erklärte.
Wie ist zu erklären, dass der Bundesminister der Verteidigung nun so plötzlich auf das Bombodrom verzichtet, nachdem ihn zuvor 27 verlorene Gerichtsprozesse, die zwei meistbetroffenen Landesregierungen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, der Bundesrechnungshof und eine wachsende Bürgerbewegung nicht zur Einsicht hatten bewegen können?
Hatte die brisante Mischung aus Protesten, politischer Lobbyarbeit, Gerichtsverfahren, direkten gewaltfreien Aktionen, Bereitschaft zum zivilen Ungehorsam etwa eine neue Qualität erreicht?
Es war wohl, und darauf bezieht sich Jung in seiner verschwurbelten Erklärung vor der Presse (siehe Info 3), vor allem die Gleichzeitigkeit des zu erwartenden endgültigen Scheiterns vor dem Bundesverwaltungsgericht und des sich abzeichnenden Verlusts der Mehrheit für das Bundeswehrprojekt im Bundestag , die den Minister und die Bundeswehr zum Befreiungsschlag veranlassten. Zugleich mag es auch der Versuch der Schadensbegrenzung für seine Partei und seine eigene Karriere gewesen sein, die Jung in die Flucht nach vorn trieb. Die Onlinekampagne von Campact, einer basisdemokratische Bewegungen äußert effizient unterstützenden Agentur, wollte ursprünglich in der Woche nach dem 9. Juni Anzeigen zum Bombodrom in Zeitungen von Jungs Wahlkreis schalten. Darin hätte er nicht sehr vorteilhaft ausgesehen.
Auf der juristischen Ebene wurde der für die FREIHEIDianer entscheidende Erfolg am 27. März 2009 errungen: Das Oberverwaltungsgericht Berlin/Brandenburg bestätigte eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam. Sie lautete, dass die Bundeswehr in der Kyritz-Ruppiner Heide nicht üben darf, weil sie die Beeinträchtigungen für die Anlieger bei ihren Planungen nicht hinreichend berücksichtigt hatte.
Am 2. Juli hat der Bundestag mit großer Mehrheit entschieden, die Petitionen gegen die militärischen Nutzungspläne der Kyritz-Ruppiner Heide der Bundeswregierung „zur Erwägung“ zu überweisen.
Der Umstand, dass die Bundesregierung bisher auch auf parlamentarische Anfragen nicht bereit ist, noch vor der Bundestagswahl den vollen Verzicht auf den Truppenübungsplatz Wittstock zu erklären, gibt allerdings zu denken.
Die FREIeHEIDe-Bewegung nimmt das zu Kenntnis. Wahre Wunder dauern anscheinend länger als 17 Jahre
Wie weiter in der Kyritz-Ruppiner Heide?
Die Botschaft der Heide ist die Heide
August 1993: Gemeinsam mit Anhängern der FREIenHEIDe durchwandere ich einen Teil des Bombodrom – Geländes. Inmitten eines Meeres blühender Heide drängt sich mir das Konversionsziel Nummer eins für diese Landschaft geradezu auf: Die Botschaft der Heide ist die Heide.
„Wer aus der Naturausstattung der Kyritz Ruppiner Heide ein auch wirtschaftlich erfolgreiches Konzept ableiten will“, so schreibe ich in das 2000 erscheinende Buch der Bürgerinitiative FREIeHEIDe, muss die Heide ‚vermarkten‘. Das heißt, sie muss zugänglich, erlebbar gemacht werden und mit einer Legende, also mit einer Geschichte verbunden werden, die Phantasie entzündet und die Sehnsucht der Menschen weckt, von denen wir wollen, das sie zu zahlenden Gästen werden.
Nur in dieser Hinsicht folge ich dem Hinweis der militärischen Seite auf die Lüneburger Heide (- die Bundeswehr hatte diese als Beispiel für die Koexistenz von Tourismus und militärischem Üben dargestellt). Die Lüneburger Heide ist populär geworden durch das Hermann-Löns-Lied und in den fünfziger Jahren durch verschiedene Heimatfilme…
Die Legende der Kyritz-Ruppiner Heide wird zurzeit von der Bürgerinitiative FREIeHEIDe geschrieben und-vielleicht-ist das Buch der FREIenHEIDe bereits das Schlusskapitel einer Erfolgsstory, die dieser seen- und waldreichen Kulturlandschaft noch ein Highlight hinzufügt: die dann wirklich zugängliche, erlebbare freie Heide.“
14. September 2009, Tourismuskonferenz der Wirtschaftsminister von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nach der Entscheidung des Bundesministers der Verteidigung vom 9.Juli2009:
Eines der Traumziele der Tourismusexperten ist der Dreiklang von Seen, Wald und Heide als Alleinstellungsmerkmal der Erholungsregion. Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismusmarketing Brandenburg, sagt, die märkische Heide, wie er die dann freie Heide wohl nennen will, könne mit der Lüneburger Heide konkurrieren. Er untertreibt: Sie ist schöner als die Lüneburger Heide. Nur ist noch verdammt viel zu tun, um sie wirklich frei zu bekommen und als Heide zu erhalten. Wenn’s denn sein muss, indem erneut alle Register des Widerstands gezogen werden. Landschaftspflegerisch, indem Vorkehrungen zum Erhalt der Heide als Heide getroffen werden.
Die Minister, der Landrat von Ostprignitz-Ruppin Christian Gilde, der Vorsitzende der Unternehmensinitiative und Bürgermeister von Neuruppin, Jens-Peter Golde, der Vorsitzende der Bürgerinitiative FREIe HEIDe, Benedikt Schirge, die Vorsitzende der Mecklenburger Initiative „Freier Himmel“, Barbara Lange, die Sprecher verschiedener Tourismusverbände, alle Rednerinnen und Redner, stimmen darin überein, dass die Region sich entschieden zur Wehr setzen wird, wenn die Bundeswehr das ehemalige Bombodrom zum militärischen Üben behalten will. Die Regierenden der beiden Bundesländer und die Meinungsführer der Region reagieren damit auf irritierende Äußerungen der militärischen Seite; haben doch Sprecher des Bundesministers der Verteidigung wiederholt nach der Entscheidung vom 9.Juli gesagt, die Bundeswehr prüfe noch, ob sie den Truppenübungsplatz Wittstock behalten will.
Phase 2 des Widerstands, wenn Bundeswehr bleiben will
Barbara Lange vom Feien Himmel sagt, die Bürgerinitiativen FREIeHEIDe, „Freier Himmel“ und „pro Heide“ seien sich einig, dass die Phase 2 des Widerstands ausgerufen wird, wenn die Bundeswehr bleibt, um mit Bodentruppen zu üben.
Sie warnt davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen.
Der Luft – Boden-Schießplatz, sagt sie, steht alternativlos im Truppenübungsplatzkonzept, da kann man nicht, wenn eine Variante gescheitert ist, einfach mit einer anderen daher- kommen. Die Steuergelder, die von der Bundeswehr für die Munitionsberäumung veranschlagt worden sind, meint sie, bleiben auch dann unsere Steuergelder, wenn die militärische Nutzung aufgegeben wird. „Einmal sollten sie in unserem Sinne eingesetzt werden“.
Damit spricht sie mir aus der Seele. Man könnte das, was sie da in gesundem Menschenverstand fordert, auch das Klagelied aller Konversionsschaffenden in Deutschland nennen. Die Bundeswehr gibt Geld nur aus, um sogenannte struktursichere Truppenübungsplätze von Munition freiräumen zu lassen. Als struktursicher gelten ihr nur die Militärareale, bei denen sie sicher ist, dass darauf geübt werden darf.
Darüberhinaus besteht die sogenannte Staatspraxis aller bisherigen Bundesregierungen, wonach der Bund lediglich das Beseitigen reichseigener Munition finanziert.
Alles andere sei, so die Rechtsauffassung des Bundes, Sache der Länder, der Kommunen und von Privatleuten. Wenn eine alliierte Bombe unter Deinem Haus geortet wird, liebe Leserin, lieber Leser, musst Du sowohl für die Kosten des Abrisses Deines Hauses als auch der Bergung der Bombe aufkommen. Auch den Neubau zahlt Dir niemand, schon gar nicht die Bundesrepublik Deutschland.
Um diesem Missstand abzuhelfen, hat das Land Brandenburg zweimal Gesetzentwürfe für ein Rüstungsaltlastenfinanzierungsgesetz in die Bundesgesetzgebungsmaschine eingefüttert.
Zweimal hatten wir die Mehrheit im Bundesrat. Im Bundestag wurde es beim ersten Mal beraten und dann sagten dort die Finanzexperten der Regierungsparteien: „Oh,
Ihr Brandenburger Schlaumeier, Ihr wollt damit noch einmal Geld, nachdem Euch der Bund die ehemaligen sowjetischen Liegenschaften geschenkt hat“. Damit hatten sie recht. Denn das Land Brandenburg hatte 1994 in einem Verwaltungsabkommen die Kosten der Altlastensanierung für die unentgeltlich vom Bund übernommenen ehemals sowjetischen Liegenschaften abbedungen, also den Bund davon ausdrücklich freigestellt.“ OK“, sagten wir, „Ihr habt uns erwischt“. Dann haben wir den Gesetzentwurf wunschgemäß abgeändert, denn es gibt ja noch jede Menge alliierter Rüstungsaltlasten in Brandenburg, z.B. in Oranienburg; und in anderen Bundesländern auch, liest man doch immer wieder von Bombenfunden. Das Regierungsviertel in Berlin beispielsweise ist auf einem Haufen nicht beseitigter Munition errichtet. Der passende „Spiegel“-Titel dazu lautete „Warten auf den großen Knall“.
Unsere Korrektur half nicht, die rot-grüne Mehrheit im Bundestag lehnte das Gesetz ab. Das hatte früher die schwarz-gelbe Mehrheit auch getan, nachdem die niedersächsische Landesregierung mit Schröder und Trittin für fast den gleichen Gesetzentwurf im Bundesrat eine Mehrheit gefunden hatte. Die Staatspraxis ist also gegen Änderungen, gleich aus welcher Richtung, imprägniert.
Das heißt für die Kyritz-Ruppiner Heide, sobald sie „an zivil“ freigegeben ist, dass innovative Lösungen zu ihrer Sanierung und Freigabe an die Öffentlichkeit gefunden werden müssen. Darüber wird zurzeit in der Region heftig diskutiert, auch gefachsimpelt.
Mehrere Handlungskonzepte sind für die Kyritz-Ruppiner Region und die FREIeHEIDe- Bewegung zur Zeit in der Diskussion
a) konversions- und tourismuspolitisch
- Der Bund soll die Heidelandschaft ins Nationale Naturerbe aufnehmen und dann unentgeltlich an das Land Brandenburg oder an Naturschutzstiftungen abgeben, um in der Kyritz-Ruppiner Heide eine Kombination von Naturschutz, sanftem Tourismus und einer schonenden wirtschaftlichen Nutzung zu ermöglichen.
- Eine Bürgerstiftung oder eine HEID-Genossenschaft soll ins Leben gerufen werden, an der sich möglichst viele einfache Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer mit Einlagen beteiligen. Wird ein ausreichendes Vermögen angesammelt, kann sie als Bieterin auftreten, wenn die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Gelände zum Verkauf ausschreibt. Von der Bürgerstiftung wird erwartet, dass sie das Gelände nach dem Erwerb nach den Bedürfnissen der Region entwickelt.
- Die Kosten der Sanierung des ehemaligen Truppenübungsplatzgeländes sollen sukzessive durch auf dem Gelände zu errichtende Anlagen erneuerbarer Energien erwirtschaftet werden, wie das bereits modellhaft auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose bei Cottbus erprobt wird.
- Mit Fördermitteln der EU, des Landes und des Landkreises soll ein Netz von Wander-, Reit- und Fahrradwegen angelegt werden; die Trassen und Seitenstreifen sind zuvor von Munition und anderen Altlasten zu befreien, damit sie gefahrlos genutzt werden können. Beispielgebend hierfür ist die Döberitzer Heide bei Potsdam, wo das Land Brandenburg auf Antrag des Landkreises Havelland mit EU- und Landesmitteln, kofinanziert durch den Landkreis, ein Wanderwegenetz von 25 km Länge geschaffen hat, wofür zuvor mit einem Millionenaufwand an Fördergeldern die Trassen und Seitenstreifen von Munition und anderen Schadstoffen freigeräumt worden sind.
- Auf jeden Fall muss der Bund dafür sorgen, dass Anwohner und Gäste der Region möglichst bald die jetzt schon gefahrlos zu befahrenden und zu begehenden Straßen und Wege nutzen können und dass die sogenannte „weiße Zone“ des Areals, die als nicht mehr belastet gilt, so aufbereitet wird, dass sie gefahrlos betreten werden kann.
b) friedenspolitisch
Die friedenspolitischen Impulse, die vom gewaltfreien Widerstand ausgegangen sind und die ihn begleitet haben, sollten für alle Welt nachvollziehbar gemacht werden: durch Ausstellungen zum „Weg der FREIenHEIDe“, durch Begegnungsstätten , durch Werkstätten zum Erlernen gewaltfreier Selbstbehauptung, die es im Ansatz bereits in Gestalt der „Sichelschmiede“ um das Ehepaar Ulrike und Hans-Peter Laubenthal gibt, durch die Erhaltung der Friedenspfarrei, die Benedikt Schirge zurzeit ausübt. Auch eine Friedensakademie in Rheinsberg, Neuruppin oder Wittstock wird erwogen. Es soll sich dabei aber nicht um eine akademische Institution im heute gebräuchlichen Wortsinn handeln, sondern um einen Ort des sehr konkreten praktischen Lernens. Für eine solche Institution sind auch andere Namen im Gespräch wie: Friedenszentrum, Friedensbildungszentrum, Volkshochschule Kyritz-Ruppiner Heide-in Anlehnung an die einstige „Volkshochschule Wyhler Wald“, die eine Zeit lang im „Freundschaftshaus“ auf dem besetzten Platz im Wyhler Wald bestanden hat. Nach dessen Räumung wurde sie abwechselnd in verschiedenen Gemeinden der Widerstandsregion aufrechterhalten.
Die Heide soll Heide bleiben und der Bund muss sich bewegen
Große Einigkeit besteht darin, dass sehr bald alles getan werden muss, damit die Heide Heide bleibt. Denn bereits jetzt werden große Anteile von ihr durch Büsche und Bäume verdrängt. Das Weiden von Schafherden, regelmäßiges Beseitigen von Büschen und Bäumen, gelegentlich auch kontrollierte Brandrodung, sind erprobte Mittel zur Erhaltung von Heidelandschaften.
Auf alle Fälle muss sich der Bund bewegen und für innovative Lösungen öffnen. Nach 17 Jahren staatlich organisierten Stillstands zu Lasten der Region wollen die Menschen dort endlich eine gefahrlos zugängliche, erlebbare freie Heide für sich und ihre Gäste.
Vom Bund werden also keine Wunder erwartet. Er soll vielmehr, verdammt noch mal, endlich seine Verantwortung gegenüber Menschen in ehemaligen Militärregionen wahrnehmen!
Roland Vogt ist Mitinitiator der Bürgerinitiative FREIeHEIDe und war bis 2006, als er mit 65 aus dem Öffentlichen Dienst ausscheiden musste, Konversionsbeauftragter im Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg