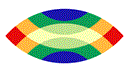Am Abend um zehn (dies wurde vor Oktober 1950 geschrieben, als er seine Arbeit als Grubenarbeiter wieder aufgab) nimmt ein teilweise kahler, recht dunkelhäutiger, athletisch aussehender Franzose in einem Overall, einundvierzig Jahre alt, seine Arbeit in einer belgischen Kohlengrube in Quaregnon auf. Er wird täglich außer sonntags acht Stunden unter Tage arbeiten. An den Sonntagen singt, predigt und betet er in seiner Kirche. Er leitet Gesprächsgruppen, ermutigt ehemalige Alkoholiker und lehrt Jugendliche zusammenarbeiten. Sein Zeitplan verlangt fast übermenschliche Kräfte.
Philippe Vernier ist vielleicht nicht von dieser Welt. Aber sicherlich ist er in ihr. Er ist so tief mit ihr verbunden, dass man mit Sicherheit sagen kann: Kaum jemals, wenn überhaupt, hat ein Mensch solche Erfahrungen gemacht und ist aus diesen Prüfungen mit einem reicheren Geist und einem stärkeren Körper hervorgegangen.
Er ist ein Mann, dessen Nest der Himmel ist. Dort liegt seine Sicherheit und nicht auf dem Boden, kuschelig warm zwischen beschützenden Zweigen und Gräsern, umgeben von Distelwolle. Wie Homers Seevogel „freut er sich seiner Schwingen“.
Wozu, so fragt er mit dem heiligen Franziskus, sind die Diener Gottes auf der Erde da, wenn nicht dazu „die Herzen der Menschen zu erheben und sie zur himmlischen Freude einzuladen?“
Das Recht darauf hat er sich verdient. 1933-1935 verbrachte er etwa zwei Jahre in Einzelhaft, weil er einer Methode treu war, die sich vollständig von der des Tötens unterschied. Während er in der Einzelzelle saß, nahm er die Gewohnheit an, seine Meditationen aufzuschreiben. Es bedurfte Jahre später großer Überzeugungskraft, ihn dazu zu bringen, dass er ihrer Veröffentlichung zustimmte. In einer dieser Meditationen stellt er Überlegungen zu zwei Arten von Mut an: „eine, die schlägt, und eine, die erträgt und liebt … Die zweite nimmt an und fängt den Schlag auf, anstatt ihn zurückzugeben.“ Dieser überlegene Mut, mit dessen Hilfe ein Mensch Tag für Tag ohne Zeugen und ohne Lob durchhalten kann, „verwandelt den Sturzbach des eigenen Wesens mit seinen Überschwemmungen und Dürren in einen schiffbaren Fluss“ (zitiert nach: „With the Master“ von Philippe Vernier, Fellowship Press, 21 Audubon St., New York).
Philipps Leben war anscheinend immer so gewesen. Kein französischer Kerker konnte sein Singen zum Schweigen bringen.
Er gestand mir viele Jahre später, dass er während dieses Martyriums „Wunder und Freude erlebt hatte. Gott war mir so nah und so real, dass mich das manchmal fast überwältigt.“ Als er einmal in hochgemuter Stimmung zu singen begann, ärgerte das einen Wächter so sehr, dass er den jungen Mann acht Tage lang an einer besonderen Strafzelle isolierte. Dort gab es weder einen Hocker noch eine Pritsche, nur eine Steinbank. Die Hälfte der Zeit bekam er nur Wasser und Brot. Aber dieses Erlebnis war weit davon entfernt, ihn zu ducken, es half ihm im Gegenteil dazu, sich zu erheben. Diese acht Tage, sagte er (und ich werde niemals vergessen, wie er seine Arme ausbreitete, als er sich daran erinnerte, wie sein Geist befreit wurde) – diese acht Tage waren „ein Lied in der Tiefe meines Herzens. Ich empfand das Glück eines Kindes, das gerettet worden war. Mir war, als ob ich auf einem Meer gewesen wäre, alle wären ertrunken und dann ergriffen mich Gottes Arme und hoben mich in die Höhe!“
Nach der Zeit in Einzelhaft verbrachte er weitere fünf Monate „mit den anderen“ und arbeitete als Friseur. Einer seiner Mithäftlinge war ein junger Schwarzer, der im Gefängnis saß, weil er einem weißen Offizier ins Gesicht geschlagen hatte. Was Verniers Freundlichkeit für diesen bedeutete, wird durch das folgende Ereignis deutlich. Der Schwarze benahm sich eines Tages auffällig gewalttätig. so dass er erwarten konnte, mit besonderer Strenge bestraft zu werden. Er hoffte, dass er in der Nähe seines weißen Freundes eingesperrt würde. Diese Hoffnung erfüllte sich. In dieser Nacht hörte Vernier eine bekannte Stimme auf dem Korridor.
„Wie bist du denn hierher gekommen?“ rief er.
Der andere erklärte seine Strategie. Die beiden in ihren voneinander getrennten Zellen lachten gemeinsam.
Immer wieder erwies sich in dem Prozess, der zu seiner Verurteilung zu einer langen Haftstrafe führte, seine Anziehungskraft und seine Führungsstärke. Der Vater eines Elfjährigen erzählte, wie dieser junge Pastor, als er in Lille mit Benachteiligten arbeitete, seinem Sohn wie ein älterer Bruder gewesen sei. Der Junge starb an Meningitis. Wenn die Schmerzen für ihn unerträglich wurden, fragte er nach Vernier, weil der der Einzige war, der ihn beruhigen konnte. Vernier betrat dann den Krankenraum, ging zu seinem Bett, legte dem Jungen die Hand auf die Stirn und betete. Der Patient schlief dann ein, aber zuvor murmelte er erleichtert, „Danke, Philo, danke!“
Vernier liebt sein Heimatland wie nur wenige – und zwar auf eine Weise, die mit seinem Gewissen übereinstimmt. Es wäre für ihn eine Art Verrat, wenn er Waffen benutzte, um etwas so Kostbares zu verteidigen. Das kann natürlich ein Militärgericht nicht verstehen. Ein Gerichtspräsident, vor dessen Gericht er stand, weil er sich geweigert hatte, eine Militäruniform anzuziehen, argumentierte so: „Sie sprechen von der menschlichen Bruderschaft, aber könnten sie diese nicht besser predigen, wenn Sie nicht im Gefängnis wären?“
Vernier antwortete: „Predigen ist nicht das Einzige. Wenn Sie zugeben, dass es geistige Werte gibt, dann müssen Sie anerkennen, dass man Gott und der Menschheit auch mit rein geistigen Mitteln dienen kann. Dazu gehört auch das Gebet.“
„Aber auch Gebet ist nicht das Einzige“, antwortete der Präsident. „Es gibt auch Worte. Sie als Pastor haben eine Kanzel zur Verfügung, um die Gute Nachricht zu verbreiten.“
„Aber“, sage Vernier höflich, aber bestimmt, „wenn ich mit etwas beginne, das ich als Verrat ansehe, dann haben meine Worte keinen Wert mehr. Ich kann nur sprechen, wenn ich mein Verhalten und meinen Glauben in Übereinstimmung miteinander gebracht habe.“
Der Präsident erwiderte, dass wir Menschen nun einmal „nicht im Absoluten leben“.
„Wenn Christen dem zustimmen“, sagte Vernier, „dann verweigern sie die Grundlagen des Dienstes an Jesus Christus.“
Das war fünf oder sechs Wochen vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Als Europa zum zweiten Mal in Angst und Hass aufflammte, verließ Vernier, obwohl er nun Pastor einer Missionskirche bei den Grubenarbeitern in Belgien in der Nähe von Mons war, seine Freu und sein Kind und meldete sich sofort bei der Militärbehörde in Frankreich, um sich als christlicher Kriegsdienstverweigerer eintragen zu lassen.
Nachdem er vier Monaten im Gefängnis gewesen war, wurde er zu weiteren vier Jahren verurteilt. Aber zuvor legte er vor dem Militärgericht folgendes Zeugnis ab:
„Ich will mit meiner Haltung durchaus weder ein Urteil über irgendeinen von Ihnen noch über die, die kämpfen, ausdrücken. Nicht durch eine Theorie wird einer zum Christen, sondern durch die Integrität des Herzens, und ich weiß, dass viele Offiziere und Soldaten bessere Menschen sind als ich. Ich bin nur ein armer Sünder, voller Fehler und in vielerlei Hinsicht schlechter als sie. Aber ich glaube, dass es an diesem Tag und an diesem Ort meine Pflicht ist, klar und deutlich meine Überzeugung darzustellen. Sie sehen das vielleicht als eine rein intellektuelle Angelegenheit an, dass die Bibel den Krieg nicht heilig sprechen kann und dass es mir unmöglich ist, einen Menschen zu töten … Zu einigen Zeiten gab es in der Geschichte eine Art christlicher Offensive. Da wurden gewisse fest etablierte Theorien bekämpft. Es war z. B. einmal möglich, Christ zu sein und trotzdem Sklaven zu besitzen. Aber eines schönen Tages kämpfte eine christliche Offensive gegen diese Idee und triumphierte über sie. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn Christen und die Menschen im Allgemeinen ihre Ansichten über den Krieg nicht ändern, sie zugrunde gehen werden. Ich gründe mich auf christliche Prinzipien….Trotz der Dunkelheit, in der wir uns befinden, trage ich eine sehr große Hoffnung in mir: Ich hoffe auf die Macht Gottes.“
Etwa drei Monate später sprengte eine explodierende Bombe die Tür des Gefängnisses. Vernier machte sich auf den Nachhauseweg. Sein Bruder war bei ihm. Ihre Reise verlief nicht besonders ruhig. Beide wurden zweimal zum Tode verurteilt: das erste Mal von der Landespolizei, die sie in eine Art Turm sperrte. Die Polizisten beschuldigten sie, zur 5. Kolonne zu gehören und schuld an der Niederlage zu sein. Aber da ihr Hauptmann nicht da war, durften sie sie nicht erschießen. Dann kamen die Deutschen und die Polizisten rannten weg. Die Männer im Turm vergaßen sie. Die beiden Brüder hatten vergeblich versucht, die Tür mit deinem Eimergriff aufzubrechen. Aus Verzweiflung waren sie dann eingeschlafen. Am nächsten Morgen kam ein Polizist und öffnete ihnen die Tür. Als er ihre Geschichte und ihre Gründe für die Kriegsdienstverweigerung gehört hatte, sagte er, sie hätten Recht. Dann umarmte er sie und ließ sie gehen.
Das zweite Todesurteil fällten die Deutschen, die sie gefangen nahmen, als sie ihrer Wege gehen wollten. Wieder hatten sie Glück. Auf dem langen Marsch flüsterte ihnen an einer Straßenbiegung ein alter Mann zu: „Lauft nach links, Jungs!“ Unbemerkt schlichen sie sich nach links aus der Reihe, liefen sehr schnell und versteckten sich 24 Stunden lang in einem Heuhaufen. Zwei Tage danach erreichten sie auf Seitenwegen Le Cambon in den Hügeln Frankreichs. Schließlich kehrte Philippe nach Quaregnon in Belgien zurück, wo seine Familie und seine Gemeinde waren.
Seine Frau Henriette war so heldenhaft und humorvoll wie er. Ihr drittes Kind, ein Junge, wurde fast wörtlich zwischen fallenden Bomben geboren – es waren unsere (amerikanische) Bomben. Eins unserer Kirchenmitglieder ging sie ein paar Tage später besuchen. Es war ein Oberst, der unter erheblicher Gefahr zum „Pfarrhaus“ vordrang. Er brachte als Zeichen der Anerkennung durch unsere Kirche Frau Vernier 150.000 $ in Francs. In seinem Brief vom 6. Februar 1945 stellt er seine Eindrücke dar:
„Nicht oft wird einem Menschen während seines Lebens Gelegenheit gegeben, ins Himmelreich eingetreten zu sein. Aber genau das empfand ich, als ich das Haus Vernier verließ … Als ich an die Tür klopfte, erschienen zwei Engel auf der Schwelle. Zwar hatten sie keine Flügel, aber die Kinder mit den strahlenden Augen, die mich begrüßten, gaben mir das Gefühl, dass ich vor der Himmelspforte stand und von zwei Cherubim hereingebeten wurde. Auf meine Frage antworteten Sie: ‚Papa ist nicht zu Hause’, dann gingen sie ihre Mutter holen. Als sie in den Flur trat, erkannte ich an der Güte in ihrem Gesicht, dass ich einer geheiligten Person gegenüberstand. Sie war höchst erfreut über eure Nachricht und die bescheidene Gabe. Vielleicht war es ebenso gut, dass ihr Mann zu diesem Zeitpunkt einen Gottesdienst in seiner Gemeinde abhielt, denn ich stelle ihn mir gerne weiter so vor, wie ihr ihn in eurem Brief beschrieben habt und wie er in den Beschreibungen der Menschen des Stadtteils erscheint – ja, sicherlich wie der heilige Franziskus. … Ich erfuhr, dass das Geld nicht in der Familie Vernier bleiben, sondern dass es dafür verwendet würde, die zu unterstützen, denen die Familie in allen diesen Jahren so aufopfernd gedient hatte. … Ich war neun Stunden in einem Eisenbahnwagen der Armee unterwegs gewesen und schließlich halb erfroren an meinem Bestimmungsort angekommen. Das waren die kältesten Stunden, die ich je erlebt hatte, aber die Wärme des Hauses, das ich betrat, machte mir klar, dass meine Leiden im Vergleich mit all den Leiden, denen diese Menschen in den letzten fünf Jahren unterworfen gewesen waren, keinerlei Bedeutung hatten.“
Nach dem Krieg war als ein Zeichen ihres Glaubens an das Leben Philippe und Henriette ein zweiter Sohn geboren worden. Die Jahre danach waren voller Arbeit, aber es gab keine Verwirrungen mehr. Ein Mitpastor gab einmal die folgende Beschreibung: „Philippe ist der Organisator, Leben und Seele einiger Ferienlager. Er ist ihr Athlet, Koch, Assistent und Pförtner, der unermüdliche Erzähler aufregender Geschichten, Autor von Theaterstücken und Schauspieler. Sie hätten ihn dabei sehen sollen, wie er den Chorgesang von hundert Jungen leitete. Er wiegte mit dem Klang seiner Flöte die Kinder in den Schlaf, bis er selbst einschlief.“
Diese Darstellung scheint zwar übertrieben, aber sie ist dennoch wahr. Nur dass Philippe ständig neue und dringendere Aufgaben übernimmt. Nachdem die deutsche Besetzung vorüber war, schrieb er, er wolle die Erfahrungen seines Lebens dazu verwenden, „einen weiteren Krieg unmöglich zu machen.“ Einige Jahre später schrieb er, dass er Fortschritte in dieser Richtung plante, indem er „versuchte, eine Gemeinschaft zu bilden, in der jeder immer mehr etwas gibt und empfängt, anders als in einer klerikalen Organisation, in denen der Pastor die spirituellen Aktivitäten monopolisiert … Seit Anfang Oktober arbeite ich als Grubenarbeiter in einer Kohlengrube im Ort. Das tue ich teilweise, um mich besser in dieses Gemeindekonzept einzubringen, und teilweise auch, um in engeren Kontakt mit den Grubenarbeitern zu kommen, unter denen ich seit zehn Jahren lebe. Das gibt mir Gelegenheit zu wunderbaren Kontakten mit meinen neuen Kameraden: Belgiern, Italienern, Deutschen, Polen, Ungarn, Litauern und anderen. … Für gewöhnlich schlafe ich am Morgen und verrichte meine Arbeit für die Kirche nachmittags und abends.“
Niemand kann Philippe Vernier mit einem einzigen Satz zutreffend charakterisieren. Allerdings gelang das fast einem verärgerten Armeeoffizier. Zwar kann sein Freund die Tatsächlichkeit dieser Geschichte nicht beweisen, jedoch ist Vernier zu wahrheitsliebend, um sie zu leugnen. Es war etwa fünfzehn Jahre zuvor. Der Offizier hatte sein Bestes getan, diesen intelligenten, bescheidenen, vitalen, fröhlichen und freundlichen Gefangenen mit dem eisernen Willen dazu zu bringen, sich zu fügen. Die Armee hatte monatelang ohne Erfolg die alten Techniken bei ihm angewendet. Danach sollte dieser Offizier einen Schlussbericht anfertigen. Dahin, wo zu diesem Zweck in dem Formular Platz gelassen war, kritzelte er verzweifelt: „Unverbesserlich christlich.“
Aus dem Buch:
Instead of cowardice or hate
COURAGE IN BOTH HANDS
Dramatic stories of real men and women who accomplished more than they believed they could
Allan A. Hunter
Copyright © 1962 by Allan A. Hunter Printed in the United States of America
BALLANTINE BOOKS, INC.
101 Fifth Avenue New York 3, N. Y.