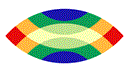"Setz Dich hin", sagt der Junge. "Ich befehle Dir, Dich zu setzen."
In seiner Hand hält er einen schweren Stein, kurz über meinem Kopf; sein Blick ist entschlossen.
Und plötzlich zählt das alles nicht mehr, die Hitze, meine Erschöpfung, der lange Weg unter brennender Sonne, mein Wunsch, mich unter einen dieser Olivenbäume zu setzen und einfach auszuruhen. Es ist, als habe jemand ein anderes Programm eingeschaltet; ich bin plötzlich in einem anderen Film.
"Setz Dich", sagt der Junge; aber ich setze mich nicht. Ich schaue auf den Stein über meinem Kopf, schaue in sein Gesicht. 14 ist er, hat er vorhin gesagt; sein Freund neben ihm, ein rotznäsige Kind, höchstens zwölf. Ich hatte damit gerechnet, daß sie versuchen könnten, mich zu bestehlen; aber an einen Vergewaltigungsversuch hatte ich nicht gedacht.
"Nein", sage ich, "ich gehe jetzt."
Aber ich kann diesem Jungen mit dem Stein in der Hand unmöglich den Rücken zukehren. Ich bleibe ruhig stehen und schaue ihn an.
"Wirklich, ich schlage zu", sagt er. "Ich bin so einer."
Ich glaube ihm nicht. Da gibt er es auf, mir mit dem Stein zu drohen. Statt dessen fangen nun beide Jungen an, an meiner Hose zu ziehen. Ich stelle mich breitbeinig hin, damit sie die Hose nicht runterziehen können; gleichzeitig wehre ich sie mit den Händen ab
"Hört auf. Laßt mich gehen."
Ich bin in einem fremden Land, ich spreche ihre Sprache nicht; aber sie verstehen ein wenig Englisch.
"Ich bin hier, weil ich Euch vertraut habe. Ihr habt gesagt, Ihr würdet mir den richtigen Weg zeigen. Laßt mich jetzt gehen."
Aber sie versuchen wieder, mir die Hose herunterzuziehen.
Wir sind in einem Olivenhain; die Jungen sind von einem nahen Haus herübergekommen, gerade als ich endlich geglaubt hatte, ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen gefunden zu haben. Wir haben uns unterhalten, Ich habe ihnen auf der Flöte vorgespielt, sie haben sich bedankt, aber irgend etwas war falsch an der Situation. Das war ihr Land, und sie schienen mich bewachen zu wollen, bis ich wieder gehe. Also ging ich.
"Nein, nicht da lang", riefen sie, "dort drüben ist der Weg, komm mit."
Und führten mich an diesen einsamen Platz, außerhalb der Ruf- und Sichtweite der nächsten Häuser.
Von beiden Seiten zerren die Jungen nun an meiner Hose. Ich stelle mich wieder breitbeinig hin, habe aber dadurch keinen so festen Stand; sie versuchen, mich umzustoßen. Wenn ich erstmal am Boden liege, denke ich, dann habe ich keine Chance mehr; ich trete den beiden in die Hoden, und sie weichen zurück. Also geht es doch nur mit Gewalt?? "Wenn Du die Wahl hast zwischen Feigheit und Gewalt", sagt Gandhi, "dann wähle die Gewalt." Ich habe das immer so verstanden: in aller Regel gibt es eine dritte Möglichkeit. Hier bin ich nun in einer Situation, wo es die nicht gibt: es gibt nur aufgeben oder Gewalt anwenden, und ich trete zu. Aber ich merke auch: diese Situation währt nur Sekunden. Sobald die Jungen zurückgewichen sind, habe ich wieder andere Möglichkeiten.
"Ihr könnt mir nichts tun", sage ich bestimmt. "Laßt mich gehen."
Dabei schaue ich den Jungen in die Augen. Der Jüngere hat jetzt einen Stock aufgehoben und versucht es damit. Als ich mich auch davon nicht einschüchtern lasse, beraten die beiden kurz, greifen mich dann an und drängen mich rückwärts in eine halb zugewachsene Grube hinein, die ich vorher nicht gesehen hatte. Mein rechter Fuß steht noch fest, mein linker Fuß bricht beim Zurückweichen plötzlich in die Tiefe ein, findet dann einen Halt einen Meter weiter unten; es raschelt. Schlangen? Ein Blick nach unten zeigt mir, daß die Grube noch viel tiefer ist. Ich verstehe nicht, was die Jungen sagen, aber die Botschaft ist deutlich: wenn ich nicht tue, was sie sagen, werden sie mich ganz da rein schmeißen.
Dann reicht mir der Ältere die Hand, zieht mich raus. Klar: sie wollen mich nicht in die Grube schmeißen, sie wollen mir nicht den Kopf einschlagen, sie haben Skrupel, mich zu verletzen. Sie sind aber nicht stark genug, mich zu Boden zu zwingen, und wollen mich deshalb einschüchtern, bis ich aufgebe und mich nicht mehr gegen eine Vergewaltigung wehre. Würde ich weglaufen oder sie angreifen, so würden sie von hinten oder im Kampf sicher ihre Hemmungen verlieren und zuschlagen; dann hätte ich wohl kaum eine Chance. Als der Junge mich herauszieht, kommt seine Gelegenheit: er wirft mich zu Boden, und im nächsten Augenblick sind beide über mir. Ich verstehe nicht warum, aber es gelingt mir, mich zu befreien: ich habe die Beine angezogen, trete dem Älteren in die Hoden, er weicht zurück, ich rolle den Jüngeren von mir herunter, rolle mich ab und stehe plötzlich wieder.
Die Jungen sind überrascht, greifen aber nach kurzer Zeit erneut an, kämpfen; ich wehre sie ab, aber nie greife ich von mir aus an, nie versuche ich, taktische Vorteile zu nutzen, zu verletzen, zu siegen. Mitten im Gerangel suche ich den Augenkontakt; ich rufe:
"Ich will nicht mit Euch kämpfen. Ich will Euch nicht verletzen. Ich hasse Euch nicht."
Es ist wahr. Ich hasse die Jungen nicht, ich bin auch nicht in panischer Angst. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen gelingen wird, mich zu vergewaltigen; aber ich weiß, daß nichts mich dazu bringen kann, mich selbst zu verlieren, diese Jungen zu hassen, sie ernsthaft zu verletzen oder gar zu töten. Das ist wichtiger; ich kann ganz ruhig sein.
Einen Moment lang überlege ich, ob ich es über mich ergehen lassen soll. Niemand zwingt mich zu kämpfen ... Aber ich spüre, daß das nicht geht. Würde ich den Widerstand aufgeben, dann würde ich etwas verlieren, was sie mir niemals mit Gewalt nehmen können...
Einer der Jungen hat mir die Geldbörse aus der Tasche gezogen. Er holt das Geld heraus, steckt den kleinsten Schein wieder hinein, gibt mir die Börse zurück.
"Gut", sage ich, "nehmt das Geld und laßt mich jetzt gehen; ich werde Euch nicht verraten."
Aber sie geben noch nicht auf. Der Jüngere findet ein Stück Stacheldraht; er droht, mich damit zu schlagen, und befiehlt mir mit wütendem Gesichtsausdruck, mich hinzusetzen.
"Wenn Du mich verletzen willst, dann tu es", sage ich und halte ihm meinen Arm hin.
Da läßt der den Stacheldraht fallen und versucht, mich zu umarmen; ich stoße ihn leicht von mir.
Noch ein weiterer Versuch folgt; wieder schaue ich den Jungen in die Augen, wieder sage ich ihnen, daß sie mir nichts tun können, und unterstreiche das mit Gesten. Dann gibt der Ältere das Signal: lassen wir's. Ich drehe mich um und gehe langsam zurück in die Richtung, aus der ich gekommen bin.
Ich bin noch nicht weit gegangen, da höre ich die Jungen hinter mir rufen, ich solle warten; sie winken mit Geldscheinen. Ich gehe noch ein Stück weiter, bis ich wieder in Sichtweite eines Hauses und etwas näher am Weg bin; dort warte ich.
"Es tut uns leid", sagen die Jungen, als sie heran kommen.
"Wenn es Euch leid tut, gebt Ihr mir dann auch mein Geld zurück?"
Der Jüngere gibt mir das Geld, der Ältere zeigt mir einen kleinen Schein und sagt, den behalte er, weil er ihn brauche. Ich zähle nach.
"Da fehlt eine ganze Menge."
"Mehr haben wir nicht. Wir müssen es beim Kämpfen verloren haben."
"Das wäre aber schade drum. Ob Ihr es nun habt oder ich - aber verloren gehen sollte es nicht. Schaut nochmal nach."
Da ziehen sie los, gehen das Geld suchen und kommen nach einer Weile mit hängenden Schultern wieder:
"Nichts gefunden."
Sie sind offensichtlich erstaunt, daß ich gewartet habe. Sie flüstern miteinander, dann läuft der Ältere los, "um nochmal zu suchen", und nach ein paar Minuten läuft der Jüngere hinterher. Ich sehe die Beiden über eine Mauer klettern und verschwinden.
Klick - umschalten. Ein heißer Tag, Mittagssonne, ich steige den Berg wieder hinauf, gehe den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ein Polizeiauto fährt vorbei. Als ich nach einem Umweg im Dorf nahe dem Olivenhain ankomme - da, wo mich die Abkürzung der Jungen hätte hinführen sollen - treffe ich den Älteren der beiden.
"Es tut mir leid", sagt er und reicht mir die Hand.
Nun, leidtun allein ändert noch nicht viel. Ich würde ihn noch einiges fragen wollen, aber dazu reicht meine Kraft jetzt nicht aus. So drücke ich nur seine Hand und sage:
"Ich vergebe Dir."
(Quelle:
Autorin und Ort sind der Redaktion bekannt; wollen nicht genannt sein.)